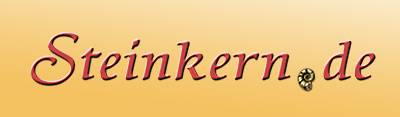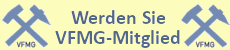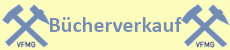Aufschluss 4-2025 – Abstracts
Themenheft Allgäuer Kalkalpen
VFMG
Trauer um Ehrenmitglied Frank Höhle
 HERBERT SCHOLZ
HERBERT SCHOLZ
Neue Zur Mineralogie und Geologie des Steinbruchs Fall bei Vils in Tirol (Außerfern, Nördliche Kalkalpen),
Teil 1: Geologie des Steinbruchs Fall
Im weitläufigen und kompliziert aufgebauten „Steinbruch Fall“ bei Vils in Tirol sind innerhalb der Nördlichen Kalkalpen Sedimentgesteine der Obertrias, des Jura und der Unterkreide aufgeschlossen. Mergel der höheren Unterkreide (Tannheimer Schichten) sowie unterschiedliche Kalksteine der Jurazeit (Schwellenkalke) werden hier als Rohstoffe für das nahe gelegene Zementwerk der Fa. Schwenk Zement (früher Fa. Schretter & Cie) gewonnen. In den hier abgebauten, dunkelgrauen Mergeln der Tannheimer Schichten kommen Barytkonkretionen vor, die seit Jahren bekannten und oft septarienartig ausgebildeten „Vilser Kugeln“. Bislang gab es nur vage Vermutungen über die Entstehung dieser großen, rundlichen Barytkonkretionen in den ansonsten augenscheinlich barytfreien Tannheimer Schichten; insbesondere die Herkunft des Bariums schien rätselhaft.
In den letzten Jahren wurden bei mehreren Begehungen des Steinbruchs durch die Autoren die unterschiedlichen, hier vorkommenden Sedimentgesteine, Neptunischen Gänge, Kluftfüllungen, Konkretionen und andere Strukturen näher untersucht und beprobt. An ausgesuchten Proben wurden unterschiedliche mikroskopische und phasenanalytische Untersuchungen durchgeführt. Neben einer überraschenden Vielfalt von Mineralien, u.a. Fluorit, Calcit, Quarz, Pyrit, Bleiglanz,
Zinkblende und Kupferkies, konnte dabei in allen Gesteinen insbesondere aber Baryt nachgewiesen werden. Das gesamte Mineralspektrum, v. a. aber das Auftreten geringmächtiger, mineralisierter Gänge in den Kalksteinen, die Fluorit, Baryt und verschiedene Sulfide enthalten, sind als deutlicher Hinweis auf eine hydrothermale Stoffzufuhr zu werten, was letztlich auch den Transport von Barium in die Tannheimer Schichten erklären könnte. Die hier erstmals beobachteten Paragenesen und Minerale, die zum Teil in mehreren Generationen auftreten, sind von größtem Interesse und ergeben in der Zusammenschau sicher neue Erkenntnisse zur Genese und der tektonischen Geschichte der hier aufgeschlossenen Schichtfolge.
In diesem ersten Teil wird auf die geologischen Gegebenheiten und den Fossilinhalt eingegangen, während im zweiten Teil die aufgefundenen und bestimmten Mineralien vorgestellt werden.
MATTHIAS HANKE,| SIMON KOCHER & KLAUS VOGT
Zur Mineralogie und Geologie des Steinbruchs Fall bei Vils in Tirol (Außerfern, Nördliche Kalkalpen),
Teil 2: Mineralien
Nachdem im ersten Teil ausführlich die Geologie (Abb. 1), die Gesteine sowie die gewonnenen Erkenntnisse vorgestellt wurden, werden in diesem zweiten Teil die im Steinbruch angetroffenen und analysierten Mineralien beschrieben.
MICHAEL BARTHLOTT
Kleinfossilien von Hartgründen und in Vilser Kugeln im Steinbruch Fall
Eine sehr gute Charakterisierung von Hartgründen gab der Bryozoen-Spezialist Ehrhard VOIGT bereits 1959: „Entscheidend ist, daß über größere Flächen hin der Kalkschlamm des Meeresgrundes diagenetisch verfestigt wird während einer Zeitspanne, innerhalb der keine Sedimentation stattfindet. Der Verfestigung des Hardgrounds kann sogar eine Abtragung vorausgehen, wobei die Entscheidung, ob diese submarin oder subaerisch erfolgt ist, sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist.“
Und weiter: „Als Folgeerscheinungen der Sedimentationsunterbrechung beobachtet man zumeist eine scharfe Obergrenze („Dach“) des Hardgrounds gegenüber dem jüngeren Sediment, während zum Liegenden hin die Grenze unscharf wird. Rinnen, Spalten, Taschen, Bohrmuschellöcher und Gänge sehr verschiedener Größe führen von seiner Oberfläche oft tief in das Gestein des Hardgrounds hinein und sind mit Hangendmaterial ausgefüllt… Manchmal ist die Oberfläche des Hardgrounds mit Pigmentglaukonit überzogen“, manchmal „mit einer Phosphatrinde“. (VOIGT 1959, S. 130).
Soweit VOIGT, dessen Beschreibung wie maßgeschneidert auch auf unsere Verhältnisse im Vilser Steinbruch Fall zutrifft. Unterhalb der Tannheimer Schichten, in denen sich die Vilser Kugeln befinden, kommen mehrere Hartgründe vor. Hartgründe sind ein Eldorado für Sammler, da sie oft „Lagerstätten“ mit Fossil- und auch Mineralkonzentrationen bilden (Abb. 1). Die folgenden Abbildungen und Fundstücke von Matthias HANKE und Klaus VOGT dokumentieren dies eindrücklich.
MANUEL FRITSCH, HERBERT SCHOLZ, TOBIAS KLÖCK & WLADYSLAW ALTERMANN
Ein säuliger Stromatolith aus der kalkalpinen Obertrias der Allgäuer Alpen
Vor vielen Jahren wurden in einer gewaltigen Rutschmasse, die in den 60er Jahren bei Hinterstein im Ostrachtal in den Allgäuer Alpen niedergegangen war, lose Kalksteinbrocken gefunden, die einen säuligen Stromatolithen enthalten. Dieser etwa 10 cm mächtige Stromatolith besteht aus eng gescharten, fingerartigen, sich immer wieder verzweigenden Säulchen, die eine interne Feinschichtung aus übereinander gestapelten, halbkugelförmigen, steil-konvex gekrümmten Lagen besitzen. Die subvertikalen Zwischenräume zwischen den Säulchen sind mit Fossilschutt aufgefüllt, u. a. mit Schalenbruchstücken von Mollusken und Brachiopoden, Echinodermenfragmenten, Kleinforaminiferen und Peloiden. Der Habitus des Gesteins, seine Farbe und sein Fossilinhalt legen eine Herkunft der Kalksteinbrocken aus den Rhaetoliaskalken im jüngeren Teil der mergeligen Kössener Schichten nahe, die oberhalb der Rutschmasse im Anbruchbereich auch tatsächlich anstehen. Die hier anstehende Schichtfolge gehört zum tektonischen Hintersteiner Fenster innerhalb der Allgäudecke, wo die Aroser Zone angeschnitten ist. Säulige Stromatolithen
dieses Typs werden nach PREISS (1976) als hs-b-Stromatolithen bezeichnet, eine Abkürzung für „hemispheroids, stacked-branching“. Sie sind schon aus dem Archäikum bekannt, im Proterozoikum verbreitet und kommen auch noch gelegentlich in kambrischen Ablagerungen vor, sind aber im restlichen Phanerozoikum weitgehend selten. Warum sie ausgerechnet hier in den kalkalpinen Kössener Schichten vorkommen, ob sie in die Kössener Schichten als durchgehender Horizont eingeschaltet sind, oder eher in Form kleiner Bioherme, ist bisher nicht bekannt.
TOBIAS KLÖCK & GIUSEPPE GULISANO
Bernstein aus der kalkalpinen Kreide des Allgäus
In der antiken Mythologie als „Tränen der Götter“ bezeichnet, übt Bernstein seit jeher eine Faszination auf den Menschen aus. Das „Gold des Nordens“ verbinden viele mit einem Strandspaziergang an den Küsten von Nord- oder Ostsee. Aber auch in den Alpen lässt sich Bernstein finden. Eine Wiederentdeckung aus der kalkalpinen Kreide des Allgäus reiht sich nun in die bisher bekannten alpinen Fundstellen ein.